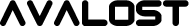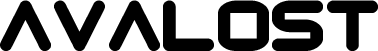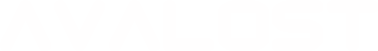Die erste Assoziation, die mir beim Titel „Kill the Light“ in den Sinn kam, ging in Richtung Leonard Cohen. „You want it darker“, sang er dereinst auf seinem gleichnamigen letzten Album, gefolgt von „we kill the flame“. Musikalisch haben Leonard Cohen und das neue Album von System Syn nichts gemeinsam, sieht man vielleicht mal von einer einigermaßen düsteren Grundstimmung ab. Aber eine Sache in dem Stück von Cohen geisterte mir darüber hinaus noch durch den Kopf, als ich in „Kill the Light“ abtauchte. Ich bin übrigens, das möchte schon mal anfügen, bis jetzt nicht wieder daraus aufgetaucht. Genau genommen ertrinke ich darin seit ein paar Tagen und nur wenig könnte gerade schöner sein. Zurück zu Cohens Lied. „A million candles burning for the help that never came“ singt er dort mit seiner Grabesstimme in einer der Strophen. Den spirituellen bzw. religiösen Unterton hat Clint Carney jüngstes Schaffenskind freilich nicht, dennoch: eine Seele, die nach Hilfe ruft, sie ließe sich auch in den Texten wiederfinden. Und wie schon so manches Mal, wenn ich versuche, das Gehörte, das mich eindeutig auf vielen Ebenen berührt und vielleicht auch ein bisschen überfordert, einzusortieren, beschließe ich, wieder einen der abendlichen Musikspaziergänge zu unternehmen. AirPods in die Ohren gestöpselt, „Kill the Light“ einigermaßen laut aufgedreht, schließlich möchte ich von der Welt um mich herum keine akustischen Reize aufgedrängt bekommen, Schuhe an und los.
Ich habe den ganzen Tag in der Bude verbracht und bin daher einigermaßen überrascht, dass es noch so warm ist, als ich vor die Türe trete. Den Hoodie hätte ich mir sparen können. Egal. Ich habe gar nicht so viel Gelegenheit, über meine Klamottenwahl nachzudenken; der Titelsong und Opener des Albums hat mich schon direkt nach den ersten Tönen wieder für sich eingenommen und beherrscht mein Denken. Wie schon die unzähligen Male zuvor, seit ich es das erste Mal gehört habe. Kein Album von System Syn war jemals zuvor mehr Synth-Pop und die Marschrichtung wird schon direkt bei „Kill the Light“ vorgegeben. Aber die virtuose musikalische Ausgestaltung des Liedes, bei dem jeder Ton so zielsicher platziert wurde wie Pinselstriche auf den Gemälden alter Meister, sie ist es gar nicht, an dem ich Herumdenke, während ich zur Kenntnis nehme, dass die Sonne gerade im Begriff ist unterzugehen und den Himmel in den dramatischsten roten und violetten Schattierungen einfärbt.
„A story made / to fit the part / the image of the man / you thought must live inside the art“ singt Clint in einer der Strophen und ein bisschen fühle ich mich ertappt. Wer hier regelmäßig einschaltet, wird vielleicht mitbekommen haben, dass ich die ersten sommerlichen Monate in einer Tagesklinik verbrachte. Und wie wir da so im Rahmen der Gruppentherapien im Kreis saßen, kristallisierte sich heraus, dass ich Gedanken und Gefühle, sofern ich sie nicht hier aufschreibe und dabei eine seltsame Distanz zu eben diesen aufbaue, hinter unüberwindbar hohen Mauern verberge. Somit also wie eine Art Entertainer agiere, mit dem Ziel, Menschen zu unterhalten, aber zu nahe kommen: bitte lieber nicht. Damals kannte ich das Lied von System Syn nicht, aber ich bin mir sicher, meine Therapeutin (freundliche Grüße an Sie, Frau Doktor, sollten Sie das hier jemals lesen) hätte ähnliche Worte gefunden wie Clint Carney: „kill the light / bring the dark / you punished them for loving you and promised it was art“. Eine typische Frage in diesem ganzen Therapiezirkus ist: was macht das mit Dir? Auch darüber denke ich nach, während der Tag der Nacht weicht. Und über die Worte meiner Therapeutin, dass ich – ich zitiere wörtlich – möglicherweise hinter den Mauern verrecke, wenn es mir nicht gelingt, sie einzureißen. Gleichzeitig ist natürlich auch denkbar, dass sie einem Schutz dienen, den mein klarer Verstand nicht erfassen kann. Ich wäre niemals so vermessen, das, was ich hier so mache, als Kunst zu bezeichnen. Aber ich merke immer wieder auch, dass mir Texte immer dann am besten gelingen, wenn es mir nicht so richtig gut geht.
„Too many words died inside me / They wanted to scream but they couldn’t break free“ (System Syn, „Endless“)
Was meine Gedanken spontan in eine andere Richtung bewegt. Joey Goebels Roman „Vincent“ (Originaltitel übrigens „Torture the Artist“) habe ich hier in den vergangenen Jahren immer wieder schon mal als Referenz gebracht und möchte das auch heute noch einmal tun. Goebel verpackt in seinem sehr unterhaltsamen, gleichwohl aber auch grausamen und ergreifenden Roman die These, dass wahre Kunst immer nur dann entstehen kann, wenn es den Kunstschaffenden nicht so richtig gut geht. In dem Buch wird der namensgebende Protagonist von seinem Assistenten immer auf die ein oder andere Weise torpediert, damit sein Talent größtmöglich Entfaltung findet – Talent, geboren aus seelischem Schmerz. Und das Motiv eines leidenden Kunstschaffenden, eines tortured artists, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das ganze Album, habe ich das Gefühl. Angesichts der musikalischen Szene, in der sich Clint Carney bewegt, aber auch nicht völlig überraschend.
Als ein weiteres Beispiel für diese Vermutung sei neben dem Titeltrack „Goodbye Fellow Traveler“ genannt, das so ein bisschen dem Problem der Selbstaufopferung für die Kunst nachgeht. Machen wir uns nix vor: die meisten Menschen, die irgendwas machen, um andere Menschen zu unterhalten und/oder Kunst zu schaffen, tun dies aus einer intrinsischen Motivation heraus. Als Idealist*innen folgen sie einem Weg, der ihre Kunst oft genug auf ewig brotlos bleiben lässt. So richtig massiv Erfolg haben eher wenige und eine Taylor Swift gibt es ohnehin nur einmal. Und doch: egal wie sehr man sich reinkniet, wieviel Herzblut man investiert, wieviel man persönlich, finanziell, menschlich opfert – immer wieder ist es nicht genug. Ist es nie genug. „There’s no parade for artists when they die alone and poor / you gave what you could / but they took all you had / and cried more, more give us more“, resümiert Clint Carney im Refrain. Dass ich die Vermutung hege, dass Carney eine bestimmte Person im Sinn hatte, als er dieses Lied schrieb, ändert an den Allgemeinplätzchen, die ich hier gebacken habe, wenig.
Während meiner Wanderungen durch die Magdeburger Innenstadt – weiß der Henker, wo ich hier schon wieder gelandet bin und vor allem auch wie! – bin ich gerade bei dem einigermaßen flotten „Where is the Love I Was Promised“ gelandet. Für einen Moment bin ich in der Lage, wieder über die feinsten Songstrukturen zu staunen, die Clint Carney hier geschaffen hat. Manche Zutaten wirken vertraut, alles klingt immer unverkennbar nach System Syn und dabei aber auch auf so aufregende Weise neu, frisch und unverbraucht, dass ich mich frage, woher der Mann die Inspiration und die Ideen genommen hat. Ist das am Ende auch so eine geknechtete Künstlerseele, die in Zeiten großer seelischer Not größte Kunst zu schaffen vermag? Darüber kann ich nur spekulieren, da ich Clint nur sehr flüchtig kenne und wir nur über Facebook in Kontakt stehen. Gründe für Musikschaffende, nicht so richtig glücklich zu sein, gab es nicht zuletzt durch die Pandemie so einige in der jüngeren Vergangenheit. Wenn man dann noch empfindlichen Gemüts durch das Leben wandelt, bietet ein Blick in die Nachrichten jeden Tag neue Gründe, an der Welt zu verzweifeln. Das wird drüben in den Vereinigten Staaten kaum anders sein als hier. Vielleicht sogar in manchen Belangen noch krasser. Jedenfalls, um auf das Lied zurückzukommen, muss ich wieder an die Therapie denken. Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass das einen großen Impact auf mein Leben hatte. Die Gründe, die mich dorthin brachten, sowieso. „I was just a child / when they taught me I would burn / whispering it was love / but that wasn’t what I learned“, heißt es dort. In Gedanken bin ich gerade wieder in diesem wenig ansprechenden Raum in der Klinik, die Stühle im Kreis aufgestellt, und 11 Augenpaare sind auf mich gerichtet, während ich stammelnd Ursachenforschung in frühkindlichen Erlebnissen zu betreiben versuche. Für eine Trigger-Warnung ist es an dieser Stelle schon zu spät, wa? Jedenfalls kann es schon sein, dass Euch dieses Album hier auf eine ganz ähnliche Weise berührt wie mich. Vor allem und ganz besonders dann, wenn Ihr ein größeres Päckchen seelischen Ballast mit Euch herumschleppt. Muss nicht zwingend das schlechteste sein, sich von Musik verstanden zu fühlen. Kann aber auch so ein bisschen zwicken in der Herzgegend.
„Was ist trauriger: ältere Menschen wegen allem, was sie gesehen, gehabt und verloren? Oder Kinder ohne jeden blassen Schimmer von allem, was sie sehen, haben und verlieren werden?“ (Joey Goebel, „Torture the Artist“ / „Vincent“)
„Kill the Light“ macht, dass ich lachen möchte und weinen und am liebsten beides gleichzeitig, weil die hier versammelten zehn Songs nicht nur handwerklich allerfeinste Düsterpop-Kost sind, sondern schlicht und ergreifend bei mir die richtigen Knöpfe drückt. Am meisten schafft es die abschließende Ballade „The Muse“. Eines der großen Themen, die mich still und heimlich beschäftigen, ist ein nie wirklich verarbeiteter Verlust eines geliebten Menschen. Krebs, Diabetes, Zuckerschock und von der Feuerwehr leblos in der Wohnung aufgefunden worden. Dazu hohe Schulden, ausgeschlagenes Erbe, anonyme Seebestattung. Die Ereignisse in Kurzform. Ich kann Euch versichern, dass einen so was durchaus aus der Bahn werfen kann. Und mit so einem Hintergrund kickt ein Refrain wie dieser natürlich so richtig rein: „You can be happy now / you can be happy now / all alone and lost at sea / waving from the shore / was never what you planned / but don’t you drift too far from me“. Schöne und ergreifende Balladen hat Clint Carney schon so einige in seiner Karriere gemacht, ich erinnere da nur an „We Had Time“ vom (regulären) Vorgängeralbum „Once Upon A Second Act“, aber „The Muse“ zieht ganz bequem an allem vorbei. Ich möchte so viel sagen über dieses Lied, weil ich merke, dass da hinter der vorhin erwähnten Mauer ein wahrer Sturm an Gefühlen tobt. Aber es gelingt mir nicht. Ich habe die Worte nicht. Vielleicht gibt es sie auch nicht. Vielleicht war es das, was die Therapeutin in der Klinik meinte als sie sagte, ich soll lernen, auf Gefühle zu achten. Lernen, sie wahrzunehmen. Gut, dass es inzwischen dunkel geworden ist und ich mich wieder meiner Bude nähere, denn Gefühle, die ich irgendwo zwischen Freude und Trauer und Schmerz und Glück und Erlösung verorten würde, brechen sich gerade bahn. Bestimmt ist mir aber auch nur irgendwas in die Augen geflogen. Durch die Brille durch. Zur bemerkenswerten Kunst von Clint Carney gehört es übrigens, dass sich zwar manche Interpretation beinahe wie auf dem Silbertablett serviert finden lässt, aber auch „Kill the Light“ wieder so viele Möglichkeiten bietet, dass Ihr alle Euch in den Texten und/oder Musik wiederfinden könnt. Je nach Stimmungslage mal mehr, mal weniger, versteht sich.
Dass man mit bestimmten Tönen bestimmte Wirkungen erzeugen kann, ist eine Tatsache, die Euch allen sicherlich vertraut ist. Schaut mal einen Horrorfilm ohne Musik. Jede Wette: Der Film hätte nicht annähernd die gleiche, aufregende Wirkung wie, wenn die spannungsgeladene Musik an Euren Nerven sägen würde. Umgekehrt halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Musik auch ohne Film den Stresslevel auf ein gewisses Niveau anzuheben vermag. Und die Töne, die Clint Carney hier über die Dauer von rund einer Dreiviertelstunde auf seine Hörerschaft loslässt, sind von so hoher Güte auf den Punkt genau platziert, dass ich mir sehr sicher bin, dass er nicht nur bei mir die richtigen Knöpfe drückt. Zumal Clint auch noch nie mehr und besser mit seiner angenehmen Stimme, die noch immer ohne Verfremdung auskommt, gearbeitet hat. Die Ausrichtung in Richtung Synthpop, weg von dem vielleicht auch schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Sound, der immer ein bisschen trockener, ein bisschen derber wirkte als das, was europäische Düsterkolleg*innen fabrizierten, steht dem Album unheimlich gut. Wenn sich Clint Carney fortan darauf beschränkte, nur noch in diesen Teichen zu angeln – bitte, gerne! Wer System Syn lieber mit ein bisschen mehr Bumms haben möchte, wird bestimmt noch den ein oder anderen Remix serviert bekommen in der näheren Zukunft. Irgendwie habe ich da so ein Gefühl. Wer weiß, vielleicht bekommt „Kill the Light“ ja auch wieder ein musikalisches Geschwisteralbum wie es „If It Doesn’t Break You“ auch eines gewesen ist.
Ich merke, ich habe schon wieder viel zu viel Worte verloren und würde am liebsten noch so viel mehr erzählen. Aber von all den vielen, teilweise wirklich ganz großartigen Alben, die in diesem Jahr bisher erschienen sind, ist „Kill the Light“ mein persönliches, absolutes Highlight. Es ist derzeit DAS System Syn-Album. Eines, das gekommen ist, um zu bleiben. Eines, das mich noch sehr, sehr lange begleiten wird. „Once Upon A Second Act“ erschien im Juni 2020, als das mit der Pandemie anfing, wirklich unangenehm zu werden. Das Album hat mich seinerzeit durch ein paar schwere Monate gerettet. Mein Leben ist gerade aus verschiedenen Gründen sehr im Umbruch. Und wenn ich anfangs schrieb, dass ich darin ertrinke, dann versteht das bitte wie: es ist der Rettungsanker. Und ich glaube, das kann es für so einige für Euch sein. In jedem Fall aber ist es ein fantastisches Album, das die Messlatte für ähnliche Werke – und auch für System Syn selbst – unfassbar hoch legt. Ich möchte immer noch singen und tanzen und lachen und weinen und alles gleichzeitig aus Freude und Dankbarkeit und Demut, etwas so schönes gehört haben zu dürfen. Ich denke an „The Muse“: you can be happy now. Ja.